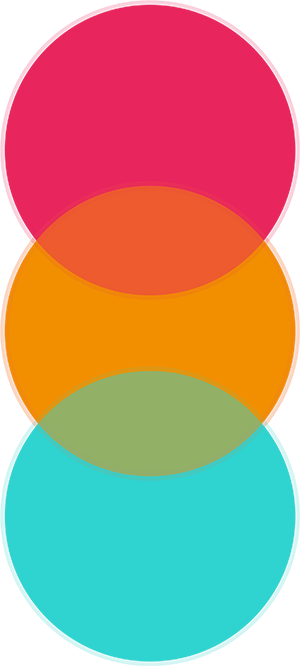Tobias Kremkau
Tobias Kremkau ist Head of Coworking und 1985 in Magdeburg geboren und aufgewachsen.
Zurückgekehrt: Tobias wohnt aktuell in Berlin.
Foto: Carolin Saage
Das Profil teilen:
Weshalb bist du zurückgekehrt?
Ich bin wie fast alle in meinem Jahrgang zum Studium nach Westdeutschland gegangen, da meiner Familie und mir das wie die einzige Perspektive vorkam, voranzukommen. In München zu studieren, als Kind einer Arbeiterfamilie – das klang für uns nach vergoldeten Kopfsteinpflastern und großer, weiter Welt. Von hier aus stand einem die Welt offen. Ich ging fürs Studium nach Venedig und fürs Auslandspraktikum nach Brüssel – und das als Münchner Student und nicht als Magdeburger. Für die Liebe, meine heutige Frau, bin ich nach dem Studium nach Berlin gekommen. Durch meine Arbeit in der ostdeutschen Peripherie von Berlin habe ich den Osten für mich wiederentdeckt und möchte nun bleiben.
Wie gestaltest du die Zukunft?
Als Head of Coworking im St. Oberholz bin ich auch für die Konzeption und Gestaltung neuer Coworking Spaces zuständig, ob nun für einen Kunden oder für unser eigenes Unternehmen. In den letzten Jahren kam es dazu, dass wir Coworking Spaces an Orten wie Frankfurt (Oder) geschaffen haben oder zu dem Thema in anderen, vornehmlich ostdeutschen Städten und Gemeinden im ländlichen Raum, beratend zur Seite standen. Ziel dabei ist immer, wirtschaftlich eigenständig operierende, inklusive Orte für die Zivilgesellschaft und (ortsunabhängig) arbeitende Bevölkerung vor Ort zu schaffen, Orte, an denen Menschen zusammenkommen können, um im Miteinander soziale Erfahrungen zu machen.
Glaubst du, deine Wende-Erfahrung bzw. die Wende-Erfahrung deiner Familie hat dich auch für den Digitalen Wandel gewappnet?
Fühlst du dich Ostdeutsch?
Meine ostdeutsche Herkunft hat lange keine große Rolle für mich gespielt. Im Münchner Freundeskreis war ostdeutsch sein auf Anekdoten reduziert, die man Freunden erzählte, für die der Osten eine unbekannte Welt war. Durch ein berufliches Projekt in Frankfurt (Oder) kam ich ab 2017 mit Gleichaltrigen von dort in Kontakt und lernte, dass deren Geschichten deckungsgleich mit meiner Jugend in Magdeburg waren. Dies faszinierte mich und schuf ein neues Gefühl von ostdeutscher Identität bei mir, geprägt von den Nachwendeerfahrungen, vor allem dem gemeinsamen Erleben von Arbeitslosigkeit und Rechtsextremismus in den 1990ern. Diese Erfahrungen machen für mich das Ostdeutschsein aus.
Wie beeinflusst dich deine ostdeutsche Herkunft?
Die Brüche in meiner Familie, auf Seiten meiner Mutter und meines Vaters, sind Reflexionen der Geschichte der ehemaligen DDR. Ein Teil meiner Familie war bei der Kirche aktiv, ein anderer Teil bei den Sicherheitsorganen – manches ist bis heute unausgesprochen geblieben. Auf beiden Seiten gab es Opfer, Täter*innen und Passive. Ich kann nur vermuten, dass die erlebten Enttäuschungen und Nachwendeerfahrungen ein Gefühl bei mir geweckt haben, sich nicht unbedacht etwas hinzugeben sowie sich stets eine geistige Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit zu bewahren. Vor allem aber hat mir meine Familiengeschichte gezeigt, dass man selbst für sich und sein Glück verantwortlich ist.
Was wünscht du dir für Ostdeutschland?
Herkunft ist keine Last, sondern eine Chance. Mich hat an meiner ostdeutschen Heimatstadt schon immer die Geschichte interessiert, die Größe und Erfolge vergangener Tage. Menschen von dort waren zu den unglaublichsten Leistungen fähig. Vieles davon ist verschwunden, aber ich glaube, dass heutzutage eine jede Region durch die Digitalisierung und die Globalisierung die Chance besitzt, etwas Neues anzufangen. Ich wünsche mir für Ostdeutschland, dass wir Menschen von hier etwas Neues schaffen, in dieser sehr gebeutelten Ecke dieses Landes, unabhängig von dem, was einst war und nun nicht mehr ist. Die Geschichte soll uns keine Last mehr, sondern eher unsere Inspiration sein.