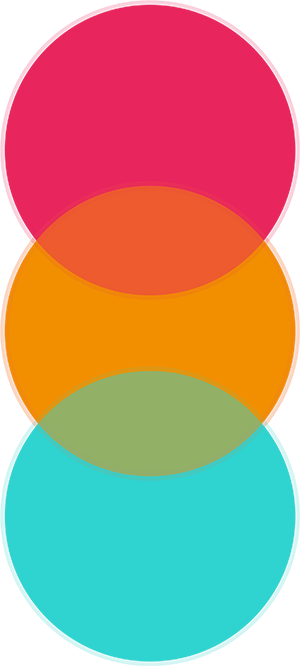Dr. Jörg Hansen
Dr. Jörg Hansen ist 1987 in Cochem an der Mosel geboren und in Simmern im Hunsrück aufgewachsen und später nach Ostdeutschland gezogen.
Rübergemacht: Jörg wohnt aktuell in Eisenach und ist Museumsdirektor des Bachhauses.
Foto: Sibylle Klepzig
Das Profil teilen:
Weshalb hast du in den Osten rübergemacht?
Das war eigentlich ganz banal. Nach meinem Jura- und Philosophiestudium in Bielefeld und Hamburg wollte ich 1999 in Logik promovieren. In Leipzig gab es einen Philosophieprofessor, der meine Arbeit betreuen wollte – und es gab dort ein schon zur DDR-Zeit sehr angesehenes Institut für Logik. Ich erhielt aber kein Stipendium und arbeitete deshalb zusätzlich in einer Anwaltskanzlei in Eisenach.
Wie gestaltest du die Zukunft?
Ich bin Leiter des Bachhauses in Eisenach. Johann Sebastian Bach wurde in Eisenach geboren, und das Bachhaus ist seit 1907 eine Pilgerstätte für Bach-Verehrer aus aller Welt. Die Wende kam für das Bachhaus erst 2001, als sich nach langem Hin und Her die Stadt, das Land und die neue Bachgesellschaft auf umfangreiche Umgestaltungen, einen Neubau und ein neues Betriebskonzept für das größte Musikermuseum Ostdeutschlands einigen konnten. Bach sollte „entstaubt“ und Eisenach als Bach-Stadt vorangebracht werden. Ich durfte diese Umgestaltung begleiten, zuerst als Assistent des Bauherrn, dann 2001 als Übergangsgeschäftsführer, und schließlich seit Ende 2005 als Museumsdirektor.
Glaubst du, Menschen in Ostdeutschland können besser mit Veränderungen bzw. Wandel umgehen?
Fühlst du dich ostdeutsch?
Nein. Ich kann nicht ostdeutsch sein: Ich habe meine ersten Erfahrungen im Westen gesammelt und die Wende nicht aus ostdeutscher Perspektive erlebt. Die Brüche in den Lebensläufen, die Existenznöte von Einzelnen oder Betrieben, der Streit um die richtige Zukunft: Das war, als ich 1999 nach Eisenach und Leipzig kam, zwar noch überall virulent, aber ich habe es eben nicht von Anfang an miterlebt. Umgekehrt fühle ich mich auch nicht westdeutsch. Die westliche Perspektive von unmittelbar nach 1989, also dass ich in einem früheren östlichen Nachbarland des „eigentlichen Deutschlands“ lebe, kann ich nicht mehr einnehmen. Der Westen ist zu lange her, aus dem Fremden ist jetzt etwas Eigenes geworden.
Welche Erfahrungen hast du in Ostdeutschland gemacht?
Die Leute sind aufgeschlossener und es gab zumindest in meiner Anfangszeit, also Ende der 90er und Anfang der 2000er, nicht soviel Dünkel wie im Westen. Die Leute waren bereit, sich selbst und ihre Ideen in Frage stellen zu lassen, das galt für Behördenmitarbeiter und gesellschaftlich oder politisch Aktive gleichermaßen.
An manchen meiner Hamburger Studienfreunde regte mich auf, dass sie sich für das ganze Gebiet Ostdeutschland nicht interessierten, Eisenach mit Eisenhüttenstadt verwechselten, mich fragten, ob ich „immer noch im Osten“ bin, und sich wunderten, als ich erwiderte, dass Eisenach westlicher liegt als Reinbek.
Glaubst du, Westdeutsche hatten nach der Wiedervereinigung im Osten Vorteile?
Nicht für alle, aber viele Berufe wie Richter, Anwälte, Steuerberater, Architekten. In Universitäten, Verwaltungen und Betrieben galten plötzlich ganz neue Vorschriften. Lebenserfahrung reichte nicht. Ausbildungen waren gefordert, die Ostdeutsche noch nicht haben konnten. Es sollte aber sofort gebaut, verwaltet, gelehrt, Recht gesprochen und wirtschaftlich entschieden werden. So kamen viele Westdeutsche in Leitungspositionen, und es kam zum Begriff des Besserwessis. Der war aber zutiefst ungerecht, weil die meisten ja ehrlich mitwirkten, das Land voranzubringen. Heute sind die Aufbauhelfer im Ruhestand, und bei Stellenbesetzungen können sich jetzt eher die Bewerber die Stelle aussuchen.
Was hast du in Ostdeutschland gelernt?
Man arbeitet mit dem, was man hat, und macht im Zweifel die Dinge selbst. 1991 war ich Praktikant im Sozialministerium von Regine Hildebrandt in Potsdam. Es waren EU-Mittel für soziale Projekte zu akquirieren. Ich hatte etwas EU-Recht gehört, also setzte man mich in eine schön verfallene Villa und erwartete, dass ich das hinkriege. Jemand anderen hatte man nicht. Ich versagte kläglich. Als ich 2001 im Bachhaus anfing, brauchte man für den Neubau ein Museumskonzept. Also machte ich das. Natürlich kam später noch viel hinzu. Aber es ging, und das Museum gewann Preise. Heute würde man eine Kommission einsetzen, ausschreiben, und eine Beraterfirma beauftragen. Dafür fehlten uns Geduld und Geld.
Was wünschst du dir für Ostdeutschland?
Dass die Menschen hier weiter so selbstkritisch, aufgeschlossen und voller Ideen und dabei so bescheiden bleiben, wie ich sie einmal kennengelernt habe. Dass wir von dem ganzen Dünkel – als Hamburger, Niedersachse, Kölner –, dem Brüsten mit dem eigenen Lebenslauf und der eigenen Herkunft, dem „Seht her, was ich und meine Vorfahren schon alles für das Gemeinwesen getan haben“, noch eine Weile verschont bleiben. Sehen Sie, jetzt habe ich doch „wir“ gesagt.