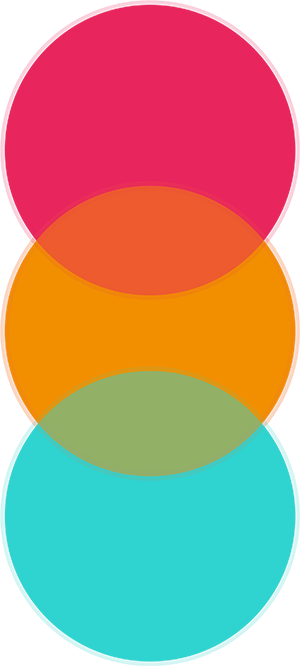Peter Maaß
Peter Maaß ist Vorsitzender der Jusos in Berlin und 1992 in Neuruppin geboren und aufgewachsen.
Gegangen: Peter wohnt aktuell in Berlin.
Das Profil teilen:
Weshalb bist du gegangen?
Die Ostprignitz zu verlassen, war eine bewusste Entscheidung. Ausgelöst durch den Beginn meines Studiums brauchte es eine gewisse räumliche Distanz, um mich als Person zu entwickeln. Ich wollte Neues kennenlernen, auf mich sich selbst gestellt sein und trotzdem den Bezug zur Region nicht verlieren. All das verbindet Berlin wie keine andere Stadt. Hier kann sich jede*r frei entfalten. Hier treffen verschiedene Lebenshintergründe aufeinander, vermischen sich und bilden etwas ganz Besonderes. Die Berliner Mischung macht die Stadt für mich so attraktiv und lebenswert. Dazu kommen ständig neue Einflüsse und Herausforderungen, unzählige Freiheiten und (politische) Gestaltungsmöglichkeiten.
Was hat dich motiviert, politisch aktiv zu werden?
Es gab nicht „den“ Moment, es waren viele Erfahrungen in meiner Jugend. Zum Beispiel war es für mich nie verständlich, dass Kinder nicht mit auf Klassenfahrt fahren oder Mitglied in einem Sportverein sein durften, weil sie aus armen Familien stammten. Dass der Bus in der ländlichen – wenn überhaupt – nur alle Stunde kam und zugleich sehr teuer war, wollte ich nicht hinnehmen. Später habe ich verstanden, wie sehr der soziale Hintergrund den Bildungserfolg beeinflusst und es keine Chancengerechtigkeit gibt.
Wie überzeugst du junge Menschen, in Ostdeutschland zu bleiben und vor Ort die Zukunft zu gestalten?
Indem ich so viel und so gut es geht mit jungen Menschen rede und sie in ihrem Engagement bekräftige. Erich Kästner sagte einmal: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Und genau das versuche ich zu vermitteln. Nur, wenn man sich für die eigenen Überzeugungen einsetzt, kann man etwas verändern. Für mich ist es wichtig, Menschen zu ermutigen, das eigene Umfeld aktiv zu gestalten und freue mich, wenn das schon in jungen Jahren passiert. Es braucht aber auch die Rahmenbedingungen vor Ort und das offene Ohr der Politik, damit diese Stimmen auch gehört werden.
Fühlst du dich Ostdeutsch?
Ich bin in Brandenburg aufgewachsen und daher ostdeutsch sozialisiert. Das heißt, die Erfahrungen der Menschen – in der Familie oder Schule – haben mich indirekt geprägt. Für mich bedeutet „Ostdeutsch-Sein“ heutzutage, dass man sich der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Unterschiede bewusst ist, ohne diese zu glorifizieren. Es gibt allerdings nicht „das“ Ostdeutsche, sondern viele verschiedene Perspektiven. Dieses Ostbewusstsein ist auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung notwendig. Denn es ist wichtig, die bestehenden Ungerechtigkeiten und fehlende Repräsentanz zu erkennen, um sie beenden zu können.
Weshalb gibt es noch immer weniger parteipolitisches Engagement in Ostdeutschland und wie möchtest du das ändern?
Ich würde sagen, die Entwicklung nach der Wiedervereinigung hat dazu geführt, dass viele junge Menschen wegzogen oder mit anderen existenziellen Herausforderungen beschäftigt waren, sodass das ehrenamtliche Engagement erstmal zurückgestellt wurde. Zudem sind die Parteistrukturen nach 1989 neu ausgerichtet worden, weshalb der Organisationsgrad anders ist als in westdeutschen Regionen.
Was machst du, damit Ostdeutsche bessere Chancen haben?
Ich versuche die ostdeutsche Perspektive stark zu machen. Als Sozialdemokrat ist mir wichtig, dass die Lebensverhältnisse angeglichen werden. Dazu zählen natürlich Lohn- und Rentenniveaus. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wieso Arbeitnehmer*innen in Ostdeutschland pro Jahr 56 Stunden mehr arbeiten, aber im Schnitt 5000€ weniger brutto verdienen. Außerdem muss sich die Daseinsvorsorge verbessern. Dazu gehören bspw. massive Investitionen in die Infrastruktur, flächendeckender und fahrscheinloser ÖPNV, kostenfreie Bildung, Ansiedlung von Forschungsinstituten, bessere Nahversorgung vor allem mit kommunale Krankenhäusern, lebenswerte Innenstädte sowie Entlastung der Kommunen.
Was wünscht du dir für Ostdeutschland?
Ich wünsche mir, dass Ostdeutschland nicht mit Perspektivlosigkeit und Rechtsextremismus in Verbindung gebracht wird, sondern als lebenswerte und tolerante Region. Ich bin mir sicher, dass es schon jetzt eine neue Generation junger Menschen gibt, die bewusst in ihrem Herkunftsort bleibt und die Entwicklung vor Ort maßgeblich positiv voranbringt. Diesen Leuten sollten Politik und Medien mehr Aufmerksamkeit schenken. Außerdem wünsche ich mir mehr politischen Willen, die Lebensverhältnisse anzugleichen und ostdeutsche Perspektiven als gleichberechtigte Diskussionspartner*innen ernst zu nehmen.