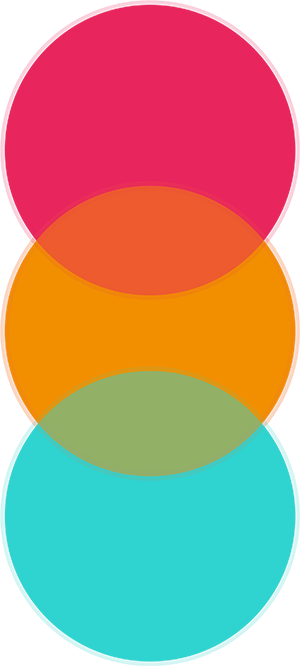Robert Nehring
Robert Nehring ist Verleger & Chefredakteur und 1974 in Ostberlin geboren.
Gegangen: Robert wohnt in (West-)Berlin.
Das Profil teilen:
Weshalb bist du gegangen?
Nach 40 Jahren Ostberlin bin ich vor sechs Jahren nach Westberlin gezogen. Das klingt nach keinem großen Schritt. Für mich war es aber durchaus einer. Etwa 30 Jahre lang kam das für mich ehrlich gesagt nicht infrage. Gründe waren dann der angespannte Wohnungsmarkt und ein nachlassendes Heimatgefühl. In Friedrichshain, Prenzlauer Berg – wo ich wohnte, wurden erst die Ostberliner weniger, später sogar die Westdeutschen. Berlinert wurde kaum noch. Dafür sprach die Bedienung in „meinen“ Kneipen zunehmend Englisch und die Gäste Spanisch.
Wie gestaltest du die Zukunft?
In meinem Verlag, dem Berliner PRIMA VIER Nehring Verlag, dreht sich alles darum, wie man Büroarbeit besser gestalten kann. Schließlich wird diese heute in Deutschland schon von 71 Prozent aller Berufstätigen geleistet. Bei uns geht es um Gesundheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, New Work, Design etc. Wir machen Magazine, Blogs, Events und unser Institut für moderne Büroarbeit DIMBA ist Plattform für Initiativen, die sich für ein besseres Raumklima, eine bessere Raumakustik und mehr Bewegung im Büro engagieren. Gerade ist unser erstes Buch erschienen: Ein Sammelband mit dem Titel „OFFICE PIONEERS: Ausblicke auf das Büro 2030“.
Glaubst du, deine Wende-Erfahrung bzw. die Wende-Erfahrung deiner Familie hat dich auch für den Digitalen Wandel gewappnet?
Fühlst du dich Ostdeutsch?
Ich bin ostdeutsch. Für mich „ist das Fakt“. Ich fühle mich auch so. Ich war und bin es gern, heute genauso wie Berliner, Deutscher und Europäer. Ostdeutsch sein ist für mich aber keine Frage der Geografie, sondern der Prägung und des Miterlebens eines Systemwechsels, der einer 180°-Drehung nahe kommt.
Wie beeinflusst dich deine ostdeutsche Herkunft?
Den Mauerfall und die Möglichkeiten, die sich mir dadurch später geboten haben, empfinde ich heute – wo es mir ziemlich großartig geht – als ganz großes Glück. Natürlich war es auch nahezu ein Luxus, vom Ost- zum Westeuropäer zu werden, ohne sich nur einen einzigen Zentimeter zu bewegen. Ich finde, dass typisch ostdeutsche Charaktereigenschaften wie Understatement, Teamplay (im Sinne von Mannschaftsdienlichkeit) und verstehen statt rechthaben wollen im Berufsleben zunehmend Vorteile statt Nachteile bringen. In der Erfahrung eines Umbruchs, der die eigene Zukunft komplett infrage gestellt hat, sehe ich heute allerdings mehr eine stärkende Abhärtung als eine „Transformationskompetenz“.
Was wünscht du dir für Ostdeutschland?
Blühende Landschaften. Nein, im Ernst: Wenigstens ein Gefühl von Wiedervereinigung bei den meisten wäre schön. Für eine echte Synthese aus These und Antithese – also etwas Neues aus dem Besten beider Welten – ist es längst zu spät. Es darf aber nicht länger sein, dass sich so viele Ostdeutsche als Opfer eines Beitritts empfinden, der sie „zu Menschen zweiter Klasse“ gemacht hat. Statt Vermögensumverteilung oder quotenbasierter Repräsentation in Ämtern und Chefetagen könnte zunächst vielleicht schon eine bloße Geste Wunder wirken: eine gemeinsame Verfassung, ein Feiertag am 9. November statt am 3. Oktober (trotz allem, was noch an diesem Datum geschah) oder eine neue, gemeinsame Hymne.